Aktuelles
Das Ende von "mehr, mehr, mehr"
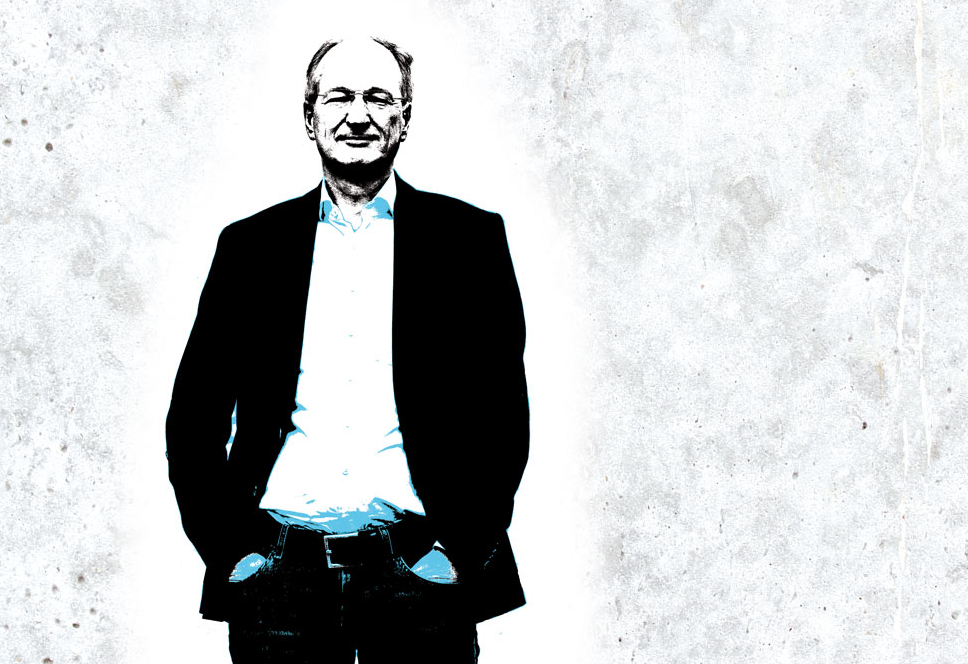
Christian Lindner sagt: Der Journalismus der Zukunft braucht nicht auf immer mehr Kanälen "mehr, mehr, mehr". Das Ziel heißt: "weniger, wertvoller, weiser". (Foto: Sebastian Laraia/Bearbeitung: journalist)
In unserer Serie "Mein Blick auf den Journalismus" fragen wir die klugen Köpfe der Branche, wie wir Journalismus besser machen. Christian Lindner, ehemaliger Chefredakteur der Rhein-Zeitung und bis vor kurzem stellvertretender BamS-Chef, sagt: Wir unterliegen einem Irrtum, wenn wir glauben, dass unser Publikum Medien genauso hochfrequent und professionell nutzt wie wir. Lindner sagt: Wir brauchen nicht "mehr", sondern "weniger, wertvoller, weiser".
Von Christian Lindner
08.12.2019
Ein neuer Tag beginnt, unser Smartphone weckt uns. Wir greifen zu diesem meistgenutzten unserer Dinge, ohne dessen Nähe wir kaum noch schlafen mögen und den Tag kaum noch überstehen können. Wir stoppen das Läuten mit einem Fingertipp. Von dort sind es nur Sekunden für das mediale Morgenritual: die Mails seit dem Einschlafen, die Eilmeldungen der Nacht, die neuen Tweets, unsere Newsletter, unsere Podcasts.
Und so lösen wir schon vor dem Aufstehen einen nie versiegenden Quell aus: den Strom aus Texten, Bildern, Audios und Videos, in dem wir den ganzen Tag schwimmen. Die wenigsten von uns Medienmachern empfinden diesen Fluss als verschlingende Flut. So groß die Vorteile, so überzeugend der Mehrwert, so reich das Angebot.
Früher musste es erarbeitet werden, gut informiert zu sein, und es hatte seine Zeit – zum Frühstück die Zeitung, bei der Fahrt zur Arbeit Radio oder Print, zur ersten Pause im Büro das Lokalblatt oder auf der Baustelle Bild, 20 Uhr die Tagesschau. Heute haben wir unsere Informationssucht schon vor dem Zähneputzen mit ein paar Klicks aus diversen Kanälen gestillt. Zunehmend hörend statt lesend, immer häufiger flanierend statt treu: Hier ein paar Links auf Twitter geklickt, dort einen Newsletter überflogen, mal Inforadio, mal Podcast, bisweilen lesen und hören wir parallel auf zwei Kanälen.
Wir Medienprofis finden diese Fülle gut. Bis zum Einschlafen fluten wir uns mit immer neuen Informationen, Bildern, Reizen. Meist mit Kleinteiligem, selten mit Langstücken. "Mehr, mehr, mehr" – auf immer mehr Kanälen. Und immer neue kommen hinzu. Wer von uns hat in den vergangenen Wochen nicht gedacht: "Dieses TikTok – ich müsste das endlich auch mal checken."
Doch Medienmacher, die in diesen vielkanaligen Zeiten Medien so virtuos nutzen: Das ist auch eine problematische Konstellation. Wer in der magischen Mühle der Medienproduktion steckt, der kann nicht mehr ermessen, wie die Flut der Informationen ankommt – da draußen, im normalen Leben.
Wir Medienprofis ticken in Vollzeit nach Medienkriterien. Wir gehen professionell mit den hochfrequenten Informationsintervallen um. Für uns sind Medien berufsbedingt Hauptsache. Und so erliegen wir einem Irrtum: Wir machen uns vor, dass unser Publikum auch so ist. Dass es auch auf immer mehr Kanälen immer "mehr, mehr, mehr" will. Dass es die Zeit und das Bedürfnis hat, all das wahr- und aufzunehmen, was wir so vielformatig wie noch nie aufbereiten, ausliefern und abrufbar halten.
Dass all das viel ist, wissen wir. Dass es für unsere Audience zu viel ist, verdrängen wir. Aber was sollten wir ändern? Dass viele unserer Journalistenkollegen und – wenn wir ehrlich sind – auch wir selber verunsichert sind, merken wir. Aber was gibt uns wieder Halt? Dass unsere Branche einen anderen, neuen und besseren Journalismus braucht, ist spürbar. Aber welchen?
Ein paar Gedanken hierzu – von einem, der noch im Bleisatz volontiert hat und am Digitalen gerade deshalb seine helle Freude hat. Ein paar Nachdenklichkeiten hierüber – von jemandem, der vier Jahrzehnte Journalismus mit Leidenschaft gelebt hat und nun, als Berater für Medienhäuser, unverändert journalistisch denkt, unsere Branche und ihr Wirken aber nun auch von außen und somit anders wahrnimmt.
Was unser Publikum braucht:
Wenn wir uns nicht als Unterhalter, sondern als Informierende verstehen, dann benötigen unsere Nutzer News, Einordnungen, ja Welterklärungsangebote, die mit ihrem individuellen Leben zu tun haben. Nicht das Wunschdenken von uns Journalisten ist der Maßstab dafür, sondern die Wirklichkeit unserer Kunden. Und zu dieser Wirklichkeit gehört, dass diese für aktive Mediennutzung viel weniger Zeit als wir Info-Vollzeitler haben – und unsere Angebote schon deshalb gnadenlos abwählen.
Redaktionsmanager, die sich trauen, Leserforschungstools wie "Lesewert" der "Mehrwertmacher" aus Dresden einzusetzen, mögen anfangs kaum glauben, dass ihre Abonnenten die bezahlte Zeitung längst nicht jeden Tag aufschlagen. Und wenn sie das tun, dann springen sie bei der Mehrheit der Beiträge schon nach der Überschrift weiter, bei vielen Texten steigen sie rasch aus, komplett gelesen wird nur ein Bruchteil.
Das hat auch, aber nicht nur mit Handwerk zu tun. Kern des Problems ist: Eine gut gemachte Tageszeitung bietet heute schlicht zu viel. Sie ist zu umfangreich, ihre Lektüre ist auch Arbeit, sie ist zeitlich nicht zu schaffen. Familie, Firma, Freizeit, Freunde – all das kollidiert mit der Zeit, die eine gute Zeitung bräuchte, von Fernsehen, Streaming, Facebook & Co. ganz zu schweigen. Ja – die Anzeigen sind zurückgegangen. Die Redaktionen aber haben ihr Programm ausgeweitet: "mehr, mehr, mehr." Und so wachsen bei Abonnenten täglich die Stapel des bezahlten, aber überwiegend ungelesenen Papiers. Stapel, die uns bei jeder Entsorgung zu fragen scheinen: "Lohnt sich dein Abo eigentlich noch?"
"Wo ist der Verlag, der das als Herausforderung annimmt und statt täglich 36 Seiten mit viel 'auch das sollte noch rein' ein Blatt mit, sagen wir, 24 Seiten bietet – nicht zum Papiersparen, sondern zur Qualitätspflege?"
Welches Medienhaus glaubt wirklich, dass die Menschen da draußen all das aufnehmen mögen und zeitlich verkraften können, was unsere Branche mittlerweile zusätzlich zu oder anstatt Print der immer gleichen Zielgruppe bietet? Website, Push, Social Media, Newsletter, Podcast – und obendrauf noch eine Sonntagsausgabe. Es ist zu viel. In der Summe ist all das womöglich die wahre Erklärung für den Abo-Schwund.
Wo ist der Verlag, der das als Herausforderung annimmt und statt täglich 36 Seiten mit viel "auch das sollte noch rein" ein Blatt mit, sagen wir, 24 Seiten bietet – nicht zum Papiersparen, sondern zur Qualitätspflege? Welche Redaktion hat den Mut, ihren Lesern in Print wie Web durch Weglassen, Verdichten und Schwerpunktsetzung zu vermitteln: Ja – wir bieten euch bewusst nicht alles, aber alles Gebotene richtig? Welches Blatt spart mir Zeit statt mir ein schlechtes Gewissen zu bereiten? Welche Medien-Website wählt gezielt Stoffe aus und ab statt immer nur "mehr, mehr, mehr" ins Netz zu kippen?
Was unsere Leute brauchen:
Für guten Journalismus brauchen wir gute Journalisten. Unsere Redaktionen aber überaltern, bluten aus. Große Teile der privatwirtschaftlichen Medien schliddern in eine Personalkrise, die vielen Häusern noch gar nicht bewusst ist.
Der Altersschnitt in deutschen Redaktionen liegt bei über 46 Jahren. Tendenz steigend. Ja, das liegt auch am Stellenabbau. Es liegt aber auch daran, dass die Medienhäuser gut ausgebildete junge Leute zu oft schon nach einigen Redakteursjahren verlieren – etwa an PR und Marketing, neuerdings auch an Schulen. Junge Kräfte, die willens sind, die Härten des Arbeitens als Journalist langfristig auszuhalten, werden knapp. Schon jetzt gibt es deutlich weniger Bewerber für Volontariate als früher, und in der Fläche können selbst unbefristete Redakteursstellen teils nicht mehr besetzt werden.
Die fatale Kombination aus mauer Bezahlung (die PR bietet mehr), unattraktiven Arbeitsbedingungen (Zeiten, unflexible Organisation, Roboten an den Desks) und fehlenden Perspektiven (die schicken Stellen hat der männliche Mittelbau besetzt) treibt uns die Talente aus den Häusern. Und die jungen Könner, die bleiben, müssen immer mehr leisten: Sie sollen neben dem Klassischen auch all die neuen Formate stemmen, und sie müssen die Scheu vieler älterer Kollegen kompensieren, mit dem Digitalen Tango zu tanzen.
Je geiziger ein Verlag ist, desto heftiger wird die Personalkrise dort durchschlagen – und sie wird im Blatt wie im Digitalen nicht zu verbergen sein. Nicht in ferner Zukunft, sondern innerhalb der nächsten Jahre, je nach Verlag und Region auch schon jetzt. Es droht, dass die verbliebenen Teams in dauernder Überforderung hamsterraden.
Umgekehrt gilt: Die Medienunternehmen, die ihren Journalisten Wertschätzung und Respekt entgegenbringen, von der Bezahlung über die Führungskultur bis zu Perspektiven, werden im Wettbewerb um gutes Personal am ehesten bestehen können. Das bedingt aber auch, dass Lokalchefs, Ressortleiter, Digitalchefs und Chefredakteure verstehen und akzeptieren: Das Modell der Arbeitstiere, die mit der Redaktion verheiratet sind, hat lange funktioniert – die Generationen Y und Z wird es vergraulen. Trotz aller neuen Anforderungen werden Führungskräfte Arbeitsbedingungen schaffen müssen, die es jungen Kollegen ermöglicht, engagiert arbeiten und gleichwohl auch leben zu können. Berechenbarer Dienstschluss, Homeoffice, Flexi-Teilzeit, Sabbaticals: ja – komplex, aber alternativlos. Und unseren Produkten wird es guttun, wenn unsere Leute Lebenserfahrung in unser Arbeiten einbringen.
Was unsere Branche braucht:
Wer in der vielfältigen und immer noch reichen Welt der regionalen Medienhäuser Deutschlands die spannendsten Labore für Forschung und Entwicklung besuchen möchte, der braucht keine komplexe Reiseplanung. Es gibt branchenweit gerade mal ein einziges Projekt, das diese Bezeichnung wirklich verdient: das HHLab von NOZ Medien und mh:n Medien in Hamburg. Ein interdisziplinäres 13-köpfiges Team erforscht dort die Zukunft der Medienwelt, erdenkt Geschäftsmodelle, entwickelt Prototypen. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist bezeichnend für die Branche. Studientouren für Verlags- und Redaktionsmanager nach Amerika sind gut gebucht – die Umsetzung zuhause bleibt Einzelkämpfern und dem Zufall überlassen.
Joachim Dreykluft, der ebenso kluge wie pragmatische Chef des HHLab, bringt es auf den Punkt. Unsere Branche denkt und handelt unverändert in den Grenzen eines Geschäftsmodells, das 150 Jahre alt ist: Medienhäuser bereiten in Generalanzeiger-Manier ein extrem breites Angebot für eine extrem breite Zielgruppe auf. Und vieles von dem, was wir in den letzten Jahren an scheinbar Neuem entwickelt haben, war in Wahrheit nur eine Variante dieses Uralt- Modells.
"Nicht 'mehr, mehr, mehr' braucht der Journalismus der Zukunft. Sondern 'weniger, wertvoller, weiser'."
Alles deutet darauf hin, dass die Generalanzeiger- Methode alleine nicht mehr trägt, sich auf Sicht generell überlebt hat. Uns dämmert die Erkenntnis, dass wir mit Print und zu lange auch mit dessen digitalen Klonen nicht wirklich Informationen, sondern in Wahrheit ein Ritual verkauft haben: Das in den Tagesablauf integrierte abrufbare Gefühl, gut informiert zu sein und so zu dieser Gesellschaft zu gehören. Nun, wo es Informationen rund um die Uhr gratis auf vielen Kanälen gibt, ist dieses Ritual nicht mehr nötig. Und wir verstehen, warum es im Netz so schwerfällt, einzelne Texte zu verkaufen: Ein nackter Artikel ist offenbar viel weniger wert, als wir glaubten – so relevant er auch scheint, so gut er auch geschrieben sein mag.
Wir Medienmacher müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass in Zukunft weniger von uns als bisher vieles an viele senden werden. Gut möglich, dass das "Generalanzeigern" eine öffentlich-rechtliche Aufgabe wird, gerade in der Fläche. Die anderen Medienmacher werden ergründen müssen, welche schmalen Zielgruppen künftig welche Art, welchen Mix und welche Übermittlung von bewusst begrenzten Angeboten wollen, brauchen und bezahlen. Nicht "mehr, mehr, mehr" auf immer neuen Kanälen, sondern bewusst weniger, in zeitgemäßer Form. Etwa in der Richtung, die Gabor Steingart und Michael Bröcker derzeit entwickeln und zu etablieren scheinen.
Journalistische Kompetenz wird beim Aufspüren, Sammeln, Sichten, Sortieren, Übersetzen und Aufbereiten dieser Informationen weiter gefragt sein. Eine gewisse Klientel wird auch Fan-Freude an medialen Leitwölfen haben, die mit Verve oder gar Furor ihre Sicht der Welt unters Volk bringen. Die Zukunft aber wird nicht den Journalisten und Angeboten gehören, die vermitteln: "Das sollten Sie denken." In unsere auch durch das Digitale ebenso aufgeklärte wie verunsicherte Zeit werden vielmehr jene Medienmacher und Produkte passen, die ihrem Publikum aufzeigen: "Das haben wir für Sie gefunden, das könnte Folgendes für Sie, Ihr Leben und unser Land bedeuten, das sollten Sie kennen."
Nicht "mehr, mehr, mehr" braucht der Journalismus der Zukunft. Sondern "weniger, wertvoller, weiser".
Christian Lindner (60) hat 1979 bei der Rhein-Zeitung (Koblenz) volontiert. Er war dort Lokalchef und 13 Jahre Chefredakteur. Danach war er stellvertretender Chefredakteur von Bild am Sonntag. Jetzt arbeitet er als Berater "für Medien und öffentliches Wirken": www.christian-lindner-consulting.de
Bisher erschienen:
Teil 1: Daniel Drepper, Chefredakteur von BuzzFeed Deutschland
Teil 2: Carline Mohr, Social-Media-Expertin
Teil 3: Georg Mascolo, Leiter des WDR/NDR/SZ-Rechercheverbunds
Teil 4: Hannah Suppa, Chefredakteurin Märkische Allgemeine
Teil 5: Florian Harms, Chefredakteur von t-online.de
Teil 6: Georg Löwisch, taz-Chefredakteur
Teil 7: Stephan Weichert, Medienwissenschaftler
Teil 8: Julia Bönisch, Chefredakteurin von sz.de
Teil 9: Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin
Teil 10: Barbara Hans, Spiegel-Chefredakteurin
Teil 11: Sascha Borowski, Digitalleiter Augsburger Allgemeine
Teil 12: Richard Gutjahr, freier Journalist, Start-up-Gründer und -Berater
Teil 13: Benjamin Piel, Chefredakteur Mindener Tageblatt
Teil 14: Josef Zens, Deutsches GeoForschungsZentrum
Teil 15: Christian Lindner, Berater "für Medien und öffentliches Wirken"
Teil 16: Nicole Diekmann, ZDF-Hauptstadtjournalistin
Teil 17: Carsten Fiedler, Chefredakteur Kölner Stadt-Anzeiger
Teil 18: Stella Männer, freie Journalistin
Teil 19: Ingrid Brodnig, Journalistin und Buchautorin
Teil 20: Sophie Burkhardt, Funk-Programmgeschäftsführerin
Teil 21: Ronja von Wurmb-Seibel, Autorin, Filmemacherin, Journalistin
Teil 22: Tanja Krämer, Wissenschaftsjournalistin
Teil 23: Marianna Deinyan, freie Journalistin und Radiomoderatorin
Teil 24: Alexandra Borchardt, Journalistin und Dozentin
Teil 25: Stephan Anpalagan, Diplom-Theologe, Journalist, Unternehmensberater
Teil 26: Jamila (KI) und Jakob Vicari (Journalist)
Teil 27: Peter Turi: Verleger und Clubchef
Teil 28: Verena Lammert, Erfinderin von @maedelsabende
Teil 29: Anna Paarmann, Digital-Koordinatorin bei der Landeszeitung für die Lüneburger Heide
Teil 30: Wolfgang Blau, Reuters Institute for the Study of Journalism der Universitäte Oxford
Teil 31: Stephan Anpalagan, Diplom-Theologe, Journalist, Unternehmensberater
Teil 32: Simone Jost-Westendorf, Leiterin Journalismus Lab/Landesanstalt für Medien NRW
Teil 33: Sebastian Dalkowski, freier Journalist in Mönchengladbach
Teil 34: Justus von Daniels und Olaya Argüeso, Correctiv-Chefredaktion
Teil 35: Benjamin Piel, Mindener Tageblatt
Teil 36: Joachim Braun, Ostfriesen-Zeitung
Teil 37: Ellen Heinrichs, Bonn Institute
Teil 38: Stephan Weichert, Vocer
Teil 39: Io Görz, Chefredakteur*in InFranken.de
Teil 40: Daniel Drepper, Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung
Teil 41: Björn Staschen, Programmdirektion NDR, Bereich Technologie und Transformation
Teil 42: Malte Herwig, Journalist, Buchautor, Podcast-Host
Teil 43: Sebastian Turner, Herausgeber Table.Media
Teil 44: Alexander von Streit, Vocer Institut für Digitale Resilienz
Teil 45: Ellen Heinrichs, Bonn Institute
Teil 46: Patrick Breitenbach, Blogger, Podcaster, Unternehmensberater
Teil 47: Caroline Lindekamp, Project Lead "noFake" beim Recherchezentrum Correctiv
Teil 48: Henriette Löwisch, Leiterin Deutsche Journalistenschule
Teil 49: Sebastian Esser, Medienmacher und Gründer
Zur Übersicht: Mein Blick auf den Journalismus