Alte Feindbilder – neue, autokratische Freunde
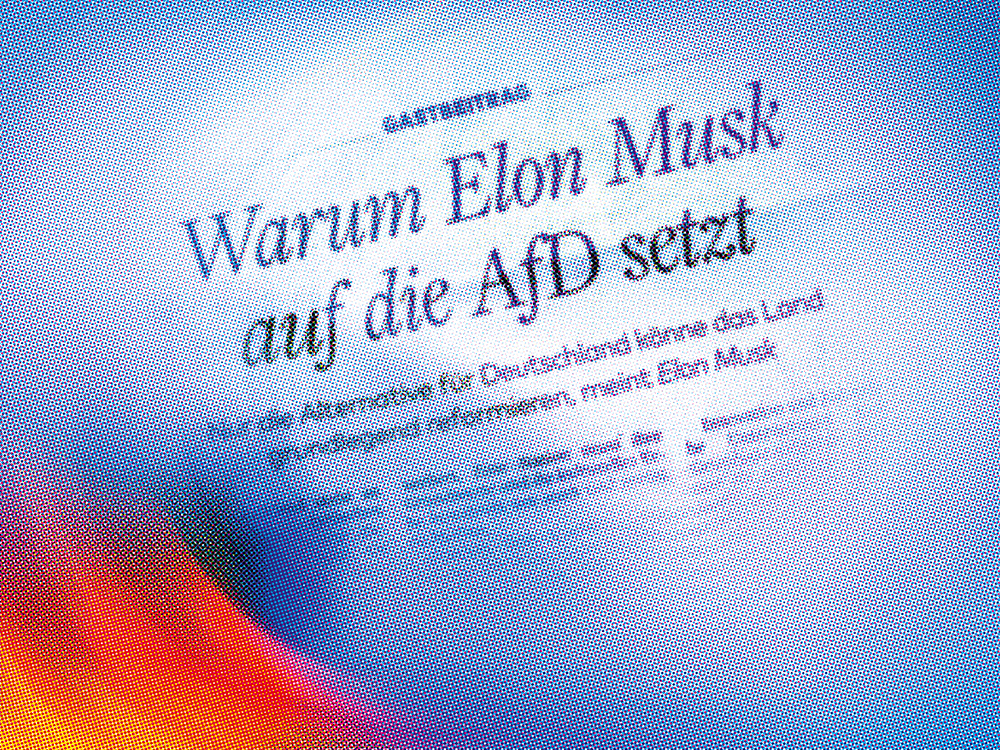
Im eigenen Haus hoch umstritten: Musks Werbung für die AFD. Foto: pa/Wolfgang Maria Weber
Elon Musk darf in der Welt am Sonntag Wahlwerbung für die AfD machen. Mathias Döpfner und Ulf Poschardt huldigen der Trump-Administration. Bild und Welt dämonisieren jene Zivilgesellschaft, die unverzichtbare Demokratiearbeit leistet, und zündeln mit rechten Kampfbegriffen. Was ist nur bei Axel Springer los?
Text: Michael Kraske
03.04.2025
Es war ein Tabubruch, der die politische Kultur dieses Landes verändert hat. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz brachte im Bundestag seinen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik mit den Stimmen der AfD durch. Erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik nahmen Demokraten eine parlamentarische Mehrheit mit den Stimmen von Rechtsextremisten in Kauf. Ex-Kanzlerin Angela Merkel tadelte Friedrich Merz öffentlich dafür. Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg kündigte an, sein Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. Der jüdische Publizist Michel Friedman trat aus der CDU aus. Bundesweit gingen Hunderttausende gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD auf die Straße. Und die Springer-Medien Bild und Welt? Starten eine Kampagne gegen zivilgesellschaftliche Organisationen, die den Protest mittragen.
„Wer steckt hinter den Massen-Demos in Deutschland?“ titelte Bild und behauptete, dass „Bundesministerien die Proteste mit Steuergeld fördern“. In dem Artikel werden dann etwa der Bund für Umweltschutz und Naturschutz (BUND) und die Omas gegen Rechts angeprangert. Dem BUND wird vorgeworfen, Geld aus dem Umwelt- und Bildungsministerium bezogen zu haben. Die Omas „kassierten“ laut Bild Geld aus dem Programm „Demokratie leben“. Richtig ist, dass zivilgesellschaftliche Organisationen für konkrete Demokratieprojekte auf der Basis von Anträgen staatliche Fördergelder beziehen. Für Schulprojekte, Workshops, Podiumsdiskussionen und politische Bildung. Sie klären über Antisemitismus, Rassismus und Extremismus auf. Die Intention ist, gesellschaftlichen Pluralismus zu fördern und demokratiefeindlichen Tendenzen zu begegnen.
Einige dieser NGOs gelten als gemeinnützig und werden steuerlich begünstigt. Dafür müssen sie zwar parteipolitisch, keineswegs aber politisch neutral agieren. Im Gegenteil: Es ist ja gerade die Aufgabe solcher Vereine und Initiativen, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren. Die Omas gegen Rechts sind kein gemeinnütziger Verein. Sie finanzieren sich eigenen Angaben zufolge vor allem aus Mitgliedsbeiträgen. Die beantragten Fördergelder für einige Regionalgruppen flossen in Projektarbeit. Bild suggeriert gleichwohl, der Staat würde die bundesweiten Demos mitfinanzieren: „Auch die Omas lassen sich ihre Demo-Kasse vom Staat aufbessern“. In den sozialen Medien kursiert seit langem die Verschwörungserzählung vom „Demo-Geld“, das angeblich für linke Demonstranten gezahlt werde. Nicht nur Bild liefert dafür neue Nahrung. Die „Chefreporterin Freiheit“ der Welt, Anna Scheider, fabulierte: „Die Regierung finanziert mit Steuergeld offenbar ihre eigene Antifa.“ Die Springer-Medien greifen die Demokratieförderung in einer Zeit an, in der ganze Regionen im Osten der rechtsextremen AfD verfallen.
Ausgerechnet jetzt wird die Legitimität von politischer Bildung durch Stiftungen, Initiativen und Vereine in Zweifel gezogen. Pikanterweise basiert die Springer-Kampagne gegen die NGOs gar nicht auf Springer-Recherchen. Quelle dafür ist ausgerechnet Nius, das populistische Onlineportal von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt. Da wittert man in Bezug auf die staatliche Demokratieförderung die ganz große Verschwörung und raunt von einem „deep state“. Sogar diesen verschwörungsideologischen Sound übernehmen die Springer-Medien fortan. Die Welt teasert den Kommentar ihres Autors Andreas Rosenfelder („Die gefährliche Macht der angeblichen NGOs“) ebenfalls mit Verschwörungsvokabular vom deutschen „deep state“ an. Der Autor versteigt sich zu der Aussage, man müsse „die manipulative Macht dieser verfassungswidrigen Institutionen brechen“. Der Autor schreibt wirklich: „verfassungswidrige Institutionen“. Der journalist hat Bild und Welt mit deren Berichterstattung konfrontiert und konkrete Fragen nach Belegen für die darin erhobenen Vorwürfe und Aussagen gestellt. Beide Redaktionen ließen den Fragenkatalog unbeantwortet. Spiegel-Redakteur Stefan Kuzmany hat den Bild-Artikel, der bei Springer den Auftakt bildete, in einem Podcast „ganz üble Stimmungsmache“ genannt. Sein Kollege Markus Feldenkirchen wertet die Berichterstattung als Kampagnen-Journalismus für die Merz-CDU.
Neutralität infrage gestellt
Tatsächlich hat die Union die Vorlage aus dem Springer-Verlag dankbar aufgegriffen und die NGOs ihrerseits politisch ins Visier genommen. Mit einer Kleinen Anfrage im Bundestag, die sie „Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen“ betitelte. 551 Fragen an die Bundesregierung beziehen sich auf etablierte zivilgesellschaftliche Akteure wie die Amadeu Antonio Stiftung (AAS), den BUND, die Omas gegen Rechts, aber auch auf das Netzwerk Recherche und die Neuen deutschen Medienmacher*innen. Etliche Fragen erfüllen gar nicht die formalen Kriterien einer parlamentarischen Anfrage, weil sie sich nicht auf Regierungshandeln beziehen. Die Kleine Anfrage im Großformat wirkt wie eine durchsichtige Retourkutsche dafür, dass die Massendemos explizit Stellung gegen die gemeinsame Abstimmung der CDU/CSU mit der AfD protestierten. Spiegel-Redakteurin Ann-Katrin Müller kommentierte auf X: „Ich dachte, ich lese eine kleine Anfrage der AfD.“ Vertreter von Stiftungen und Vereinen sprechen von einem Angriff auf die Zivilgesellschaft und werfen der Union gezielte Einschüchterung vor. Das Netzwerk Recherche, das 1.300 Journalist*innen unterschiedlicher Überzeugungen vertritt, hält es „für eine gefährliche Entwicklung, wenn die Union die Gemeinnützigkeit etablierter journalistischer Organisationen in Frage stellt“. Stichwortgeber für CDU/CSU sind Bild und Welt.
Bei der Attacke auf missliebige Nichtregierungsorganisationen arbeiten Springer und CDU/CSU nicht nur Seite an Seite. Vielmehr verbreiten sie auch die absurde Darstellung, Demokratiearbeit und Extremismus-Prävention seien irgendwie „links“. Vor der von Nius gezündeten Springer-Kampagne war die Agitation gegen die Demokratieförderung zivilgesellschaftlicher Organisationen ein Alleinstellungsmerkmal der extremen Rechten. Vor einigen Jahren hat der rechtsextreme AfD-Politiker Björn Höcke bei einer Rede in Dresden der Zivilgesellschaft offen den Kampf angesagt. Seither wird die AfD nicht müde, permanent politische „Neutralität“ einzufordern, um ungestört ihre rechtsextreme Agenda vorantreiben zu können.
„Bei der Attacke auf missliebige Nichtregierungsorganisationen arbeiten Springer und CDU/CSU Seite an Seite“
Nunmehr bedienen sich also Springer-Redaktionen und Christdemokraten der gleichen Argumente. Der Satiriker Jan Böhmermann dokumentierte in seiner Sendung, dass Bild mit der organisierten Unterstützung für Demos ansonsten kein Problem hat – solange die politische Richtung stimmt. Als rund 100 Wirtschaftsverbände zu einem „Wirtschaftswarntag“ in Berlin mobilisierten, titelte Bild: „Das ist Notwehr“. Mobilisiert hatte für die Demo, zu der laut Polizei gerade mal 450 Leute kamen, die Lobby-Gruppe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Deren Chef: CDU-Mitglied Thorsten Alsleben. Der Bild-Artikel dazu liest sich wie Demo-PR, inklusive Porträt-Fotos der prominenten Demo-Teilnehmer Christian Lindner und Wolfgang Kubicki von der FDP. Wenn aber bundesweit Hunderttausende für eine rote Linie zur AfD demonstrieren, wittert man bei Springer eine Verschwörung.
Bild sei „mit der Kampagne gegen die NGOs und die Zivilgesellschaft wieder ganz bei sich“, analysiert Medienwissenschaftler Volker Lilienthal von der Uni Hamburg. Er erinnert daran, wie Bild seinerzeit gegen die außerparlamentarische Opposition der 68er-Studentenproteste anschrieb. Heutzutage bilde „eine vitale Zivilgesellschaft auch eine Art außerparlamentarische Opposition“. Deren Protest gegen die Union heiße die eigene, überalterte Leserschaft offenbar nicht gut: „Diese Stimmung greift Bild redaktionell auf und facht sie weiter an.“
Poschardt teilt aus
Medienberater Wolfgang Storz, vor Jahren Co-Autor der Studie Drucksache Bild, sieht die Springer-Medien als Getriebene auf einem Aufmerksamkeits-Markt, den mittlerweile eben auch toxische Anheizer von Nius über Youtube-Kanäle und rechte Influencer bis zum rechtsextremen Compact-Magazin füttern: „Da versuchen sie bei Bild schrittzuhalten. Um publizistisch aufzufallen, muss man immer noch einen drauflegen.“ Bei Springer sei viel von verantwortlichem Journalismus in polarisierenden Zeiten die Rede, so Medienforscher Lilienthal: „Ich kann nicht erkennen, dass es von diesem hehren Anspruch in der Berichterstattung über Reizthemen auch nur Spurenelemente gibt.“ Nach wie vor gelte das journalistische und wirtschaftliche Geschäftsmodell, „aus den virulenten Streitthemen unserer Gesellschaft Kapital zu schlagen“. Die Glut der Unzufriedenheit, egal ob es um Migration oder Demos gegen Rechts geht, werde immer weiter angefeuert. „Ich halte das für unverantwortlich“, sagt Lilienthal.
Mehr noch: Führende publizistische Köpfe des Verlags agieren, als befänden sie sich selbst im Kulturkampf. Allen voran Welt-Herausgeber Ulf Poschardt und Welt-Redakteurin Anna Schneider. In journalistischen Kommentaren und auf der Plattform X schreiben sie mit fanatisch anmutendem Furor gegen alles und alle an, die sie irgendwie als links, grün oder „woke“ verorten. All jene schmäht Schneider als „Nannystaatler“. Wenn Hunderttausende nach der gemeinsamen Abstimmung von CDU/CSU und AfD im Bundestag auf die Straße gehen, polemisiert die Journalistin gegen „Anstandstänzer“ mit angeblich fragwürdigem Demokratieverständnis. Nicht selten ergießt Schneider beißenden Hohn über einem „linken Hühnerhaufen“, an dem sie sich abarbeitet. Selbst ernannte Anständige würden sich demnach „lieber mit Moral als mit Bier betrinken, während sie ihren Namen tanzen. Und der Name heißt Brandmauer“.
Diese Verächtlichkeit gegenüber Andersdenkenden teilt sie mit Welt-Herausgeber Poschardt. Den christlichen Kirchen wirft er in einem Kommentar vor, sich vom Glauben verabschiedet „und sich in ein rot-rot-grünes Bündnis für Umverteilung, Grenzöffnung und LGBTQ+-Aktivismus verwandelt“ zu haben. Sein Essay-Buch über die „kulturelle Dominanz“ von einem angeblichen „Shitbürgertum“ musste er im Selbstverlag publizieren, weil es dem zu-Klampen-Verlag zu polemisch war und dieser von der geplanten Veröffentlichung Abstand nahm. Den scharfen Ton der Verachtung, den Poschardt und Schneider für den Springer-Verlag setzen, kultivieren auch die Redaktionen von Bild und Welt, wenn sie sich über „Gender-Gaga“, „Moral-Eliten“ und „Woke-Kultur“ echauffieren. Der journalist hat die beiden Redaktionen nach dem Grund für den Gebrauch des Kulturkampf-Vokabulars der radikalen Rechten angefragt. Bild und Welt ließen die Anfrage inhaltlich unbeantwortet. „Im aktuellen Springer-Kurs steckt ganz viel Ideologie“, sagt Medienforscher Lilienthal.
„Der Kommentar von Elon Musk hat den Rechtsextremismus der AfD mit seinen brutalen völkisch-nationalistischen Zielen und Ideologien im Zeitraffer weiter normalisiert“
In dieses Bild passt auch der Abdruck des Gastkommentars von Elon Musk in der WamS. Der Milliardär aus dem Trump-Team nutzte dieses Geschenk zur faktenfreien Wahlwerbung für die AfD, die er im rechten Sound als „letzten Funken Hoffnung“ für Deutschland anpreist. Verlags-Reaktionen auf die vernichtende öffentliche Kritik, die sich auf „Meinungsfreiheit“ berufen, lassen erahnen, wie resistent man bei Springer gegen jegliche Kritik ist. Der Kommentar von Elon Musk hat den Rechtsextremismus der AfD mit seinen brutalen völkisch-nationalistischen Zielen und Ideologien im Zeitraffer weiter normalisiert. Als AfD-Fürsprecher promotete die WamS ausgerechnet jenen milliardenschweren und reichweitenstarken Systemsprenger, der sich als autoritärer und folgsamer Trump-Jünger geriert und die Plattform X zu einer monströsen digitalen Maschine für ungefilterte Hassbotschaften und Propaganda umgewandelt hat.
Die Entscheidung für den inhaltlich dürftigen Text von Elon Musk war intern heftig umstritten. Die Leiterin des Welt-Meinungsressorts, Eva Maria Kogel, kündigte nach der Veröffentlichung ihren Job. Auch Investigativjournalist Hans-Martin Tillack warf laut Medienberichten hin. Eine journalist-Anfrage ließ Tillack unbeantwortet. Im Vorfeld der WamS-Veröffentlichung gab es heftigen Widerstand gegen die Publikation.
Berichten zufolge kritisierte der Redaktionsausschuss, der Musk- Deal stehe „in krassem Widerspruch zu den Essentials von Axel Springer“. Nur: Geändert hat es nichts. DJV-Chef Mika Beuster kritisierte die Publikation „als Journalismus verpackte Wahlwerbung für eine rechtsextreme Partei“ und warnte: „Deutsche Medien dürfen sich nicht als Sprachrohr von Autokraten und deren Freunden missbrauchen lassen.“ Springer beeindruckte das nicht. Im Gegenteil. Die offiziellen Reaktionen signalisierten: Alles richtig gemacht. Weiter so. Eine journalist-Anfrage zur Musk-Kontroverse blieb inhaltlich unbeantwortet.
Zur Vorgeschichte gehört die publizistische Verehrung Elon Musks durch den langjährigen Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt. Titel eines Kommentars im Dezember 2023: „Sein großes F*** them ist der Triumph der Freiheit über die Woke Kultur“. Mit seiner Bewunderung für den Milliardär ist Poschardt bei Springer indes nicht allen. Der Verlag ehrte den Tech-Milliardär im Jahr 2020 mit dem Axel Springer Award. Aber es geht um mehr als um fragwürdigen Personenkult. Mittlerweile betätigt sich Elon Musk für Donald Trump als Abrissbirne und zerschlägt mit Massenenttlassungen den Behördenapparat.
Nichts als Bewunderung für J.D. Vance
Die Spitze von Axel Springer huldigte nach der Musk-Kontroverse weiter der Trump-Administration. Als US-Vize J.D. Vance den europäischen Demokratien auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgrund angeblich fehlender Meinungsfreiheit demokratiefeindliche Tendenzen andichtete und mit Blick auf die AfD gar ein Ende der „Brandmauer“ forderte, waren sich kritische Beobachter in Politik und Medien einig: Das war ein Angriff auf die westliche, liberale Demokratie. „Schock-Rede“, kommentierte das Handelsblatt. Und die Springer-Medien? Zunächst fand Welt-Herausgeber Ulf Poschardt lobende Worte für Vance. Springer- Chef Döpfner legte in einem Interview mit der Financial Times nach und nannte jene Rede, die Europa tief erschüttert hat, eine „inspirierende Botschaft“, die Reaktionen der Europäer hingegen „weinerlich, unklug, unstrategisch und sogar gefährlich“. FAZ-Kommentator Harald Staun kritisiert Döpfners Lob für Vance als „missverstandene Meinungsfreiheit“. Sogar die konservative Konkurrenz wundert sich.
Auch Medienwissenschaftler Volker Lilienthal übt scharfe Kritik an dem Springer-Kurs und erkennt bei Poschardt und Döpfner „durchaus eine Neigung zu libertären Positionen“. Er erinnert daran, dass Wissenschaftler*innen in den USA mittlerweile nicht mehr frei forschen können. „Die Pressefreiheit wurde unter Trump bereits massiv eingeschränkt. Wo bleibt denn da die Meinungsfreiheit?“, fragt Lilienthal. „Einerseits sieht Poschardt die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht. Gleichzeitig wird mit der Huldigung des Trump-Kurses implizit gutgeheißen, wenn unter dessen Präsidentschaft die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt wird.“ Der frischgebackene Welt-Herausgeber begebe sich „mit seinen Wortmeldungen in unauflösbare Widersprüche“.
Durch die autoritäre Brille betrachtet, bedeutet Meinungsfreiheit immer nur die Freiheit der eigenen Leute, so Lilienthal: „Das darf aber nicht sein. Meinungsfreiheit muss für alle gelten.“ Der Medienforscher räumt ein, dass es in Zeiten permanenter Disruption kurzzeitig auch bei Verlegern und Journalisten zu „Anpassungsschwierigkeiten“ kommen könnte. „Gleichwohl kann das keine Entschuldigung sein. Nach kurzer Bedenkzeit müsste man auch bei Springer zu einer eindeutigen Einschätzung kommen“, sagt Lilienthal. „Dass nämlich die grundlegenden Werte des Westens angegriffen werden.“ Es gehe um Menschenrechte für alle und dass sich jede und jeder frei äußern könne. Queere Gemeinschaften etwa lebten derzeit in großer Angst. Die liberale Gesellschaft sei in den USA akut bedroht. Trotz eindeutiger Befunde geht der Eiertanz um die journalistische Haltung bei Springer weiter. Nachdem Trump und Vance den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, den Trump zuvor als Diktator verhöhnt hatte, im Oval Office vor einem Weltpublikum gedemütigt und fallengelassen hatten, kommentierte Springers Washington-Korrespondentin Stefanie Bolzen: „Selenskij hat mit seinem Verhalten die Sicherheit Europas aufs Spiel gesetzt.“ Der zugehörige Teaser trieb die Täter-Opfer-Umkehr auf die Spitze: „Selenskij hätte schweigen müssen!“ Das provozierte innerhalb des Springer- Universums prominenten Widerspruch. Paul Ronzheimer (Bild) und Robin Alexander (Welt) meldeten sich kritisch zu Wort. Es brodelt bei Axel Springer.
„Emotionalisierung, Aufmerksamkeit um fast jeden Preis und markige Schlagzeilen gehören seit je her zur DNA von Springer“
Schließlich sah sich Verleger Mathias Döpfner zu einer spektakulären 180-Grad-Kehrtwende genötigt. In seinem Kommentar war nunmehr davon die Rede, die neue Trump-Regierung würde im Stundentakt rote Linien überschreiten. Nun endlich vollzog auch Döpfner nach, was er bisher mit Ausreden zu kaschieren versuchte: „Unsere Weltordnung wankt.“ Auf Spiegel Online kommentierte das Anton Rainer bissig: „Er liebt ihn, er liebt ihn nicht.“ Der Autor befand, Döpfner „inszeniert sich als oberster Kritiker des Präsidenten, für dessen Wiederwahl er einst gebetet hat. Leidet er an Vergesslichkeit – oder hofft er auf die der anderen?“ Hintergrund: Eine von der Washington Post geleakte E-Mail, in der Döpfner vor Jahren ein Gebet zur Wiederwahl Donald Trumps anregte. Wofür sich Trump wiederum in einem digitalen Post bei dem „very brillant Mathias Döpfner“ bedankte. Trump und Döpfner – eine komplizierte Beziehungskiste.
Wie sich das Haus Axel Springer in der gegenwärtigen Epochenwende positioniert, hat aber natürlich nicht nur ideologische und persönliche, sondern allen voran handfeste wirtschaftliche Gründe. Schließlich sind die USA mit Business Insider und dem Mega-Investment Politico ein wichtiger Markt für den Verlag. Ausgerechnet diese konservative Springer-Tochter geriet Anfang Februar ins Visier von Donald Trump, der Politico als „linkes Revolverblatt“ verunglimpfte. Eine Sprecherin des Weißen Hauses kündigte an, Regierungsbehörden sollten entsprechende Abos des Fachdienstes Politico Pro kündigen. Politico gehört neben CNN, NBC News und New York Times zu jenen Medien, die künftig nur noch von außen über das Pentagon berichten sollen. Der Axel Springer Verlag steht wie alle anderen journalistischen Medienhäuser in den USA enorm unter Druck. „Springer sieht sich aktuell offenbar gezwungen, es sich nicht mit der Trump-Administration zu verscherzen“, sagt Medienforscher Lilienthal. „Geschäftliche Interessen spielen eine wichtige Rolle. Offenbar nimmt man sich gerade nicht die Freiheit, die es bräuchte, um die weltpolitische Lage unbefangen zu beurteilen.“
Emotionalisierung, Aufmerksamkeit um fast jeden Preis und markige Schlagzeilen gehören seit je her zur DNA von Springer. Aber selbst bei Bild achte man durchaus darauf, bei allen Provokationen nicht gänzlich die Reputation der Mehrheitsgesellschaft zu riskieren, so der Medienberater und Publizist Wolfgang Storz. Mit Kampagnen gegen kriminelle Migranten und angeblich faule Arbeitslose wähnt man sich immer auch als Sprachrohr einer wenn auch rohen Mehrheitsmeinung. Der aktuelle Schlingerkurs aber berührt existentielle Grundwerte, die sie im Springer-Verlag demonstrativ vor sich hertragen: pro Westen, pro liberale Demokratie, pro Rechtsstaat – gegen jede Form der Autokratie. Wenn Springer-Größen wie Poschardt oder Döpfner nunmehr offene Angriffe auf die liberale Demokratie zu einer „inspirierenden Botschaft“ umdeuten, zerstört das die journalistische Glaubwürdigkeit der Marke. Das kann auch renommierten Springer- Journalisten wie Paul Ronzheimer nicht egal sein, der seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wichtige Aufklärung betreibt und profunde Analysen liefert.
In den „Essentials“ der „Unternehmensverfassung“ stehen bei Axel Springer unmissverständlich hehre Ansprüche wie in Stein gemeißelt. „Wir treten ein für Freiheit, Demokratie und ein vereinigtes Europa“, heißt es da, und: „Wir lehnen politischen und religiösen Extremismus ab“. Wer all jene, die demokratische Brandmauern zu Demokratiefeinden verteidigen, journalistisch an den Pranger stellt, aber sich mit denjenigen gemein macht, die sie niederreißen wollen, sollte sich dringend an die eigenen „Essentials“ erinnern – oder sich ehrlicherweise von ihnen verabschieden.
Michael Kraske lebt als Journalist in Leipzig. Aktuelles Buch: „Angriff auf Deutschland – Die schleichende Machergreifung der AfD.“
Anmerkung: In einer früheren Version des Textes hieß es, der Welt-Autor versteige sich zu der Aussage, man müsse „die manipulative Macht dieser verfassungswidrigen Organisationen brechen“. Tatsächlich war die Rede von "verfassungswidrigen Institutionen". Wir haben die Passage geändert.